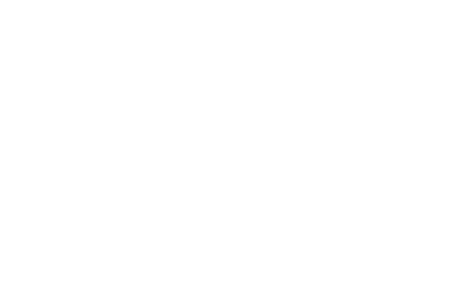Leseprobe
Kapitel 1, Seite 17-33
Der erste Kontakt
Wie ein Geist glitt das Mädchen aus dem Nebel, stolperte vorwärts und versuchte sich zu erinnern, wo es war. Es dauerte ein paar Augenblicke, bevor das Mädchen Marie all die schwer greifbaren Fäden ihrer Gedanken zusammengerafft hatte, um sich bewusst zu machen, was sie hier tat. Benommen, aber wieder auf ihr Ziel konzentriert, folgte sie dem Weg.
Wie jeden Morgen ging Marie die Straße entlang, die von ihrem Haus zur Schule führte. Wie sie es hasste, früh aufzustehen. Ihr Herz schlug für die Nacht. Sobald es dunkel wurde, wuchsen ihre Lebensgeister, bis sie wieder ihre volle Größe angenommen hatten. Also immer dann, wenn es in der normalen Welt Zeit war, zu Bett zu gehen.
Seltsame befremdliche Welt, dachte sie. Warum läuft in meinem Leben alles verkehrt?
Der feuchtkalte Nebel, der die gesamte Umgebung in ein fahles Grau getaucht hatte, konnte ihre Verwirrung und ihre Lustlosigkeit nicht im Geringsten verbessern. Marie schüttelte den Kopf und öffnete krampfhaft die Augen, um ihre tiefsitzende Müdigkeit zu vertreiben.
Es war eisig kalt. Sie zog sich rasch den Kragen über die Nasenspitze und stopfte ihr langes, dunkles Haar noch tiefer unter ihren Mantel. Eine unbestimmte Angst war das Einzige, was ihren Puls schneller schlagen ließ.
Dieser Tag verhieß nichts Gutes. Müdigkeit, Kälte und Angst. Eine abscheuliche Kombination, die ihr die Entscheidung nicht gerade leichter machte, welchen jener drei Geister sie zuerst loswerden wollte.
Marie schaute sich um. Diese unbestimmte Angst ließ sich nicht abschütteln. Sie sah die lange Reihe der Häuser entlang. Ihr Blick schweifte über die ganze Umgebung, als sie in der Ferne eine Person erblickte. Vier Häuser weiter erkannte sie eine Gestalt. Marie kniff die Augen zusammen, um genauer zu erkennen wer da auf sie zukam. Mitten auf der Straße ging ein Mann und kam langsam näher. Obwohl er nur leichte, weiße Gewänder trug, schien er nicht zu frieren. Er winkte freudig und lachte über das ganze Gesicht. Eigentlich sah er ganz sympathisch aus, befand Marie. Doch Erwachsenen konnte sie nicht trauen.
Sofort verstärkte sich das seltsam anmutende Gefühl, das sie immer dann überkam, wenn Erwachsene vorgaben, etwas Gutes für sie tun zu wollen. In der Regel artete dieser Versuch in eine große Enttäuschung für sie aus.
Nichts wie weg, dachte sie und beschleunigte ihre Schritte. Wenn ich ihn abhänge, dann brauche ich mich erst gar nicht mit ihm zu beschäftigen.
Marie drehte den Kopf und stellte erleichtert fest, dass dieser eigentümliche Mann enttäuscht aufgab, hinter ihr her zu gehen. Er hatte offenbar wirklich versucht sie einzuholen.
Es ist besser so, dachte Marie. Wieso sollte ein wildfremder Mann versuchen, mit mir auf offener Straße zu sprechen? Erleichtert wendete sie sich wieder ihrem tatsächlichen Ziel zu.
Wie so oft war Marie in Gedanken versunken, als ihr Blick auf das graue Haus direkt vor ihr am Ende der Straße fiel. Ihre Nackenhaare stellten sich auf, und der Anblick ließ die gefühlte Temperatur um ein paar Grade sinken. Dieses graue Ungetüm verlor nicht an Bedrohlichkeit, obwohl Marie beinahe jeden Tag daran vorbei ging. Warum hatte dieses alte, verlassene Gebäude eine solche Macht? Keiner wusste, was es damit auf sich hatte. Viele Bewohner aus der Nachbarschaft konnten so manch schauderhafte Geschichte darüber erzählen.
Am harmlosesten erschienen noch die Erzählungen von Verstorbenen, die sich von der Angst der Menschen nährten und jeden aussaugten, der dem Haus zu nahm kam.
Jedes Mal, wenn sie an diesem grauen Haus vorbei ging, hatte sie jedoch das unbestimmte Gefühl, sie müsse hineingehen. Als ob das Haus sie rufen würde.
In Gedanken versunken stand Marie nun direkt vor dem verfallenen Bauwerk. Ihr Blick wanderte über die unebene Fassade, die trüben Fenster und die verwitterten Fensterbretter. Eine Veranda erstreckte sich über den größten Teil der Front. Der Anblick wirkte beinahe einladend, wären nicht die dunklen Schatten und morschen Balken gewesen, die sich zu bewegen schienen. An den vergilbten Holzbrettern, die die gesamte Fassade überzogen, klebten vertrocknete Ranken einer Pflanze, die früher einmal versucht hatte, diesem Haus etwas Leben einzuhauchen. Marie beobachtete das graue Gebilde, das eine Seele zu besitzen schien. Ihr schauderte ein wenig und sie war gerade im Begriff ihren Weg fortzusetzen, als sie der Drang, dieses Haus von innen zu erkunden, neuerlich überkam. Obwohl es unheimlich war, hatte Marie Zeit ihres Lebens immer mehr Furcht vor Menschen verspürt als vor Geistern und Schauergeschichten. Sie beschloss, jeder Vernunft abzuschwören. Eine aufkommende Neugierde verdrängte ihre anfängliche Angst nahezu gänzlich.
Langsam hob sie einen Fuß und setzte ihn behutsam auf die erste Stufe des Treppenaufgangs. Voller Aufregung blickte sie zur Haustüre hinauf, die sie lautlos, aber nachdrücklich ins Innere des Hauses einlud.
Alles an diesem Haus war grau. Marie stellte sich vor, wie es mit etwas Farbe aussehen würde. Mit jeder Stufe stieg ihre Zuversicht und verwandelte sich zunehmend in erregte Begeisterung.
Wenige Schritte von der Haustüre entfernt hielt sie inne, um sich umzusehen. Neben der Türe sah sie ein Schild, auf dem in schwarzen Lettern etwas geschrieben stand. Neugierig, wem dieses Haus gehören könnte, kniff sie die Augen zusammen, um die Schrift besser lesen zu können. Langsam schienen sich die Buchstaben zu verändern und mit einem Mal konnte sie die Schrift ganz deutlich lesen.
»ZONYAHAMAR - Herrschaftshaus der Zonjasy«, stand da geschrieben. Vibrierend hallten diese Worte in ihrem ganzen Körper nach. ZONYA-HA-MAAAR. Marie zuckte zusammen. Schleichend wurde ihr bewusst, dass sie sich davor gefürchtet hatte, dieses Haus zu betreten. Ihre Angst loderte erneut auf. Eine geheimnisvolle Macht griff nach ihrem Herzen und presste es langsam, beinahe genüsslich, zusammen. Marie stockte der Atem. Tränen flossen über ihre Wangen. Sie empfand eine mächtige Welle des Schmerzes und der Trauer. Dunkle Gesichter und Gestalten tauchten vor ihrem inneren Auge auf. Dieser Schmerz stammte nicht von ihr. Eine unbestimmte Kraft hielt sie zurück, als sie flüchten wollte.
Plötzlich strich ihr etwas über den Rücken. Eine leichte Bewegung, die ihr die Nackenhaare erneut aufstellte. Hastig blinzelte sie die Tränen fort und sah sich um.
Sofort setzte sie sich in Bewegung, direkt auf die Haustüre zu, die sie instinktiv anzog, um dort in Deckung zu gehen. Ihre ersten Schritte waren etwas unbeholfen, als wäre sie stundenlang bewegungslos dagestanden. Mit aller Macht zwang sie sich vorwärts, um dieser beklemmenden Situation zu entkommen. Bleischwer fühlten sich ihre Beine an, zogen sie hinab, als wollten sie ihr Vorankommen verhindern.
Schließlich stand Marie vor der Haustüre. Sie klopfte zaghaft. Abermals verstärkte sich der Druck dieser kalten Klauen in ihrer Brust. Nach Luft ringend hämmerte sie panisch an das morsche Holz. Stockend und knarrend öffnete sich die Tür. Marie blickte sehnsüchtig auf diesen dunklen Spalt in der Hoffnung, er möge sich vergrößern und dem Ganzen ein Ende setzen.
Kaum hörbar vernahm sie ein leises Klingeln. Sie blickte sich hastig um. Doch wo kam es her? Allmählich wurde das Klingeln lauter und plötzlich saß sie schweißgebadet in ihrem Bett. Sie benötigte ein paar Augenblicke, um zu sich zu kommen.
Verdammt, schon wieder dieser schreckliche Traum! Doch so weit wie diesmal war sie noch in keinem Traum an das Haus herangekommen.
Ein nochmaliges Klingeln holte Marie ein weiteres Stück in die Realität zurück. Sie sprang aus dem Bett und huschte ins Badezimmer. Eilig lief sie zur Haustüre, während sie sich einen Bademantel überwarf.
Der Postbote, der draußen stand, überreichte ihr lächelnd ein Paket. Verdutzt betrachtete Marie das braune Bündel in ihrer Hand, auf dem ihr Name stand. Ihre Frage, von wem diese Postsendung sei, verhallte in der morgendlichen Luft. Der Mann hatte das Haus bereits verlassen und eilte auf dem Schotterweg zur Straße.
Warum hatte ihre Tante nicht die Türe geöffnet? Egal. Noch etwas benommen streckte sich Marie und ließ das Paket neben die Eingangstüre auf den Boden sinken. Mit den Gedanken noch in ihrem Traum verhaftet, schlurfte sie in die Küche, um sich einen Schluck Kaffee zu genehmigen.
Das Haus hat mich angezogen, das habe ich ganz genau gespürt. Marie schüttelte sich. So ein Schwachsinn!, dachte sie, jetzt werde ich schon ganz ver…, schnell spitzte sie ihre Lippen und pfiff leise vor sich hin.
Mit einer raschen Handbewegung wischte sie dieses, ihr so ungeliebte, Wort weg. Sie wollte es nicht denken, geschweige denn aussprechen.
Maries Mutter war vor vier Jahren in eine psychiatrische Anstalt eingeliefert worden. Seit damals war dieser dichte, nebelhafte Knoten in ihrem Kopf, der immer dann auftauchte, wenn es darum ging, verhaltensauffällige Menschen oder absonderliche Situationen zu beurteilen. Es genügte, wenn ihre Gedanken in die Nähe dieses Wortes kamen. Sie wusste einfach nicht, wie sie dazu stehen sollte. Marie hatte ihre Mutter nie als verrückt empfunden. Für sie war sie einfach anders. Anders als die meisten Menschen, die sie kannte. Und doch wusste Marie, dass am Verhalten ihrer Mutter etwas nicht gestimmt hatte.
Am prägendsten war jedoch das Verhalten, das die Menschen an den Tag legten, wenn sie über ihre sonderbare Mutter sprachen. Marie hasste diesen Gesichtsausdruck, bei dem ihr Mund hinter einer vorgehaltenen Hand verschwand und sich die Augen verdrehten, als wollten sie vor Abscheu aus dem Kopf springen.
Marie hatte die Männer für verrückt gehalten, die in ihr Haus gekommen waren, um ihre Mutter abzuholen. Sie sprachen mit ihr, als seien sie selbst verwirrt. Von da an begleitete sie ein Gefühl der Desorientierung, da alles falsch zu sein schien, was ihr ihre Mutter beigebracht hatte.
Seit vier Jahren lebte Marie bei ihrer Tante, ihrem Onkel und deren Kindern Mara und Sanil am Rande von Walen, in einem kleinen Haus mit Garten. Walen war die Hauptstadt von Ostaria und lag inmitten einer zerklüfteten Gebirgslandschaft, die durch weitläufige Seen und unberührte Wälder unterbrochen wurde. Ansonsten wusste Marie nicht viel über ihr Heimatland. Nur gelegentlich hatte sie Walen mit ihrer Mutter verlassen, um durch die Wälder zu streifen.
Sie hatte diese Ausflüge geliebt. Regelmäßig erzählte ihr ihre Mutter von all den Wesenheiten, die in den Bäumen, Pflanzen und Steinen lebten. Wie Marie jetzt erfahren hatte, eine weitere Behauptung, die nicht der Wahrheit entsprach, war doch ihre Mutter geistig verwirrt.
Maries Mutter Roja war immer etwas verträumt gewesen, sehr zum Leidwesen der restlichen Familie. Neben ihren Eltern, ihrer Schwester, ihren Onkeln und Tanten hatte sie immer so gewirkt wie ein vereinzeltes Gänseblümchen inmitten von gedrungenen Steinbauten. Allerdings ahnte diese Blume nicht, dass sie anders war. Roja schien die Farbe Grau nicht zu kennen und sich nicht daran zu stören, wenn sie Kritik ausgesetzt war oder gemieden wurde. Vielleicht ein Anzeichen dafür, dass schon immer ein Wesen in ihr geschlummert hatte, das sich durch die schlechten Erinnerungen fraß, bis nur noch schöne und angenehme da waren.
Anfangs hatte sie nur das eine oder andere vergessen. Mit der Zeit vermehrten sich die Phasen des Vergessens, griffen gierig auf ihr gesamte Leben über und letztendlich schien sie selbst ihre über alles geliebte Tochter aus ihrem Gedächtnis gestrichen zu haben. Lange Zeit hatte niemand bemerkt, was bei ihnen zu Hause vor sich ging. Zuletzt hatte Marie sich so gut es ging alleine um den Haushalt gekümmert und inständig gehofft, dass ihre Mutter doch noch eines Tages aus ihrem andauernden Dämmerschlaf erwachen würde.
Ausgerechnet an ihrem achten Geburtstag waren diese Männer gekommen und hatten ihre Mutter in eine Anstalt gebracht. Tagelang hatte Marie geweint und es fiel ihr heute noch schwer, wieder Freude zu empfinden. Das unfreundliche Verhalten ihrer Tante hatte es ihr zusätzlich schwer gemacht, sich in ihrer neuen Familie wohlzufühlen. Heute mit zwölf Jahren hatte sie sich halbwegs an ihr neues Leben gewöhnt.
»Kaffee ist nichts für Kinder«, keifte Tante Irin hinter Marie, während sie sich nach der Kanne streckte. »Und bring das Paket in dein Zimmer. Wir werden noch alle darüber stolpern. Womit habe ich das verdient? Da nehme ich dich auf in unserem schönen Heim und dann machst du nur Blödsinn und Unordnung.«
Zeternd führte Tante Irin ihren Monolog fort, in dem Marie zum wiederholten Male zu hören bekam, wie sehr sie ihrer Mutter glich. Chaotisch, unaufgeräumt und realitätsfremd. Dies waren die Charaktereigenschaften, die ihrer Tante in Verbindung mit ihrer unerwünschten Sippschaft einfielen.
Marie hörte ihrer Tante nicht mehr zu. Ihr Blick schweifte über ihr blondiertes, strähniges Haar. Es sollte aussehen wie die Frisur einer feinen Dame. Seidig glänzende Locken, die sich in perfekter Harmonie um die steifen Gesichtszüge legten. Bei Tante Irin sah es so aus, als wäre sie nach einem Friseurbesuch in den Regen gekommen. Ihre Tante hasste ihr dunkles Haar, das sie zu sehr an die Verwandtschaft mit ihrer Schwester erinnerte.
Seit dem einschneidenden Erlebnis vor vier Jahren hatte Marie sich sehr verändert. Sie sah ihrer Mutter nicht mehr so ähnlich wie zuvor, was sie sehr bedauerte. Ihre Haare waren mit der Zeit grau geworden, ihre Haut fahl und ihre Augen schwarz. Es schien, als sei jegliche Farbe von ihr abgefallen.
»Kannst du dir nicht wenigstens farbige Kleidung anziehen. Die Nachbarn reden schon über uns.«
Was Tante Irin jedoch nicht bemerkt hatte, war, dass Marie früher sehr wohl bunte Pullover und T-Shirts besessen hatte. Doch auch ihre Farben waren mit der Zeit verblasst, als hätten sie ihre Leuchtkraft vergessen und sich ebenfalls der Trauer hingegeben.
»Wir müssen dir bald wieder die Haare färben«, bemerkte Tante Irin, als sie Marie beobachtete, wie diese über ihr sprödes Haar strich.
Ohne den Blick zu heben, nickte Marie. Tante Irin wollte nicht, dass ihre Mitmenschen glaubten, sie würde sich nicht gut genug um sie kümmern. Marie war das recht. Mit den gefärbten Haaren bot sie eine geringere Angriffsfläche für Hänseleien in der Schule. Es war ihr verhasst auf diese Weise aufzufallen. Das war zudem nicht die einzige körperliche Eigenart, durch die Marie hervorstach.
Unvermittelt hob sie den Kopf, da sie ein violettes Licht aufblitzen gesehen hatte. Sie betrachtete ihre Physea in der Spiegelung des gegenüberliegenden Fensters. Diese runde Stelle zwischen ihren Augen, die jeder Mensch in Ostaria hatte und die zumeist in einer bestimmten Farbe leuchtete, war bei Marie ebenfalls meistens farblos. Nur manchmal leuchtete sie blitzartig auf. Grundsätzlich war dies nichts Besonderes. Außergewöhnlich war, dass Marie bereits jetzt, in so jungen Jahren, diese Physea entwickelt hatte. Für gewöhnlich sollte dies erst in einem Alter von 14 oder 15 Jahren geschehen. Bei Marie hatte sich dieses körperliche Merkmal bereits mit zehn Jahren erstmals gezeigt. Es fiel einfach auf, wenn dieses farbige Auge im Unterricht plötzlich aufblitzte. Vor allem, da sie die einzige mit dieser Auffälligkeit war. Auch wenn Marie nichts dafür konnte, waren die Lehrer genervt. Ein Fest für jene Mitschüler, die mit Vorliebe die Schwächeren und Sensibleren unter ihnen drangsalierten.
Durch all diese Umstände wählte Marie jetzt ihre Kleidung danach aus, ob sie ihren Kopf und ihr Gesicht damit verstecken konnte. Nicht immer wurde es geduldet, dass sie eine Kapuze oder eine Haube tief ins Gesicht gezogen trug.
Marie wollte nicht daran denken. Diese Tatsache nahm ohnehin einen großen Teil ihres Lebens ein. Sie wünschte sich nur einen Tag, an dem sie keine Angst haben musste und nicht dadurch gezwungen war an ihre Besonderheiten zu denken.
Beim Blick zum Fenster entdeckte sie ihren Onkel Menos im Garten. Er war ein Mensch, dem scheinbar alles egal war. Wichtig war ihm nur, jede freie Minute in seinem Garten verbringen zu können. Er züchtete Rosen, trank Tee und blickte verträumt vor sich hin. Marie hatte deshalb bald mehr als nur Tee in seiner Kanne vermutet.
Vor ein paar Monaten, als sich ihr Leben wieder einmal unnötig verkompliziert hatte, hatte sie sich eine Kanne von diesem sonderbaren Tee stibitzt. Dieses kleine, aber süße Geheimnis sollte sie in eine bessere Welt entführen, so hoffte sie jedenfalls. Maries Mutter hatte ihr viel über die Wirkung von Kräutern erzählt. Wie sie auf den Körper, den Geist und die Seele wirkten: »Manchmal genügt es, wenn ich sie ansehe oder daran rieche und ich fühle mich besser.«
Vielleicht kannte Onkel Menos ebenfalls die verborgene Wirkung der Pflanzen? Doch es handelte sich tatsächlich nur um normalen, langweiligen Kräutertee. Danach hatte sich Marie sogar noch schlechter gefühlt.
Marie mochte ihren Onkel gerne. Er hatte stets ein Lächeln für sie übrig und erzählte ihr interessante Geschichten über die Welt der Pflanzen. Sie sah ihn jedoch nur selten. Vorherrschend bekam sie das rüde Wesen ihrer Tante zu spüren. Marie hatte sich stets gewundert, wie Tante Irin und Onkel Menos jemals zusammengefunden hatten.
Schlagartig wurde Marie aus ihrer Lethargie gerissen. Mara und Sanil, die beiden Kinder von Tante Irin und Onkel Menos, stolperten unter lautem Gezeter herein. Instinktiv duckte sich Marie, als auch schon eine Scheibe Butterbrot über ihren Kopf hinwegflog. Mara, die wie Marie zwölf Jahre alt war, ließ keine Gelegenheit aus, ihr das Leben schwer zu machen.
»Daneben«, zischte Marie grinsend und erhob sich aus ihrer Deckung.
»Marie hat ihr Butterbrot auf den Boden geworfen«, petzte Mara, während sie Marie nicht aus den Augen ließ. »Wir sollen doch nicht mit Essen spielen.«
Genervt fuhr Tante Irin herum und sah Marie wütend an.
»Das stimmt doch nicht«, fuhr Sanil dazwischen. »Ich habe es genau gesehen. Mara hat …«
»Ruhe! Seid alle ruhig!«, schrie Tante Irin mit hochrotem Kopf. »Kann man nicht wenigsten am frühen Morgen seine Ruhe haben?! Mara und Sanil, geht in eure Zimmer! Du, Marie, hebst dein Pausenbrot vom Boden auf. Wir sprechen später darüber, wie man mit Essen umzugehen hat.« Mit einer unwirschen Handbewegung schnitt sie Marie das Wort ab, die gerade Einspruch erheben wollte.
Lautlos formte Marie noch das Wort »Danke«, während sie Sanil nachblickte. Er war in all der Zeit der Einzige, der stets hilfsbereit und freundlich zu ihr gewesen war. Onkel Menos war durchaus nicht grob, wie es Tante Irin zuweilen war. Marie schien ihm jedoch nichtsdestotrotz gleichgültig zu sein. Obwohl Sanil erst acht Jahre alt war, verstand er am ehesten, wie verloren sich Marie fühlte. Ihm erzählte sie heimlich Geschichten, was Tante Irin nicht wissen durfte. In ihren Augen waren Phantasiegeschichten der Inbegriff allen Übels.
»Kind, du musst mit beiden Beinen im Leben stehen. Geschichten können dir nicht weiterhelfen. Und wage es ja nicht, meinen Kindern diese Flausen in den Kopf zu setzen.«
Marie sah häufig Bilder in ihrem Kopf. Vage Silhouetten von sonderbaren Figuren oder gar ganze, abgeschlossene Geschichten. Innerhalb weniger Sekunden waren die Handlungsabfolgen in ihrem Bewusstsein. Es war wie eine Erinnerung, die sie noch Augenblicke zuvor nicht gehabt hatte. Für sie war dieser Vorgang immer normal gewesen. Erst mit der Zeit erkannte sie, dass dies für andere Menschen keine Selbstverständlichkeit war. Zuweilen meinten die Erwachsenen, wenn sie ihnen davon erzählte, sie hätte eine rege Phantasie. Marie bemerkte ihre abschätzigen Blicke, wusste aber zum damaligen Zeitpunkt nicht, wie sie sie deuten sollte. Ihre Mutter hatte sie stets dazu ermutigt, davon zu erzählen, was sie sah. Heute behielt Marie dieses Wissen lieber für sich.
Resigniert hob sie das Butterbrot vom Boden auf und versuchte, Steinchen und Haare aus der fettigen Oberfläche zu zupfen. Sie beschloss, es auf dem Weg zur Schule loszuwerden. Als Jause taugte es ohnehin nicht mehr.
Wie gewohnt stürmte Marie im letzten Augenblick zur Türe hinaus. Sie zog sich ihre Kapuze über den Kopf und wischte sich noch schnell über den Mund. Wie üblich vermutete sie, noch Zahnpastaspuren in ihren Mundwinkeln.
Während Marie überlegte, was sie wohl heute vergessen haben könnte, stolperte sie beinahe über einen kleinen Hund. Sie richtete ihre Entschuldigung in Richtung Boden und übersah die verdutzte Besitzerin.
Die meiste Zeit fühlte sich Marie anders als andere Menschen. Auch wenn es oft als erstrebenswert galt, anders zu sein, wollte sie einfach nur dazugehören. Der Verlust ihrer Mutter als Eckpfeiler in ihrem Leben verstärkte dieses Gefühl umso mehr.
Im Übrigen besaß Marie nicht sonderlich viele Freunde. Eigentlich gar keine. In der Schule hatte sie nie viel Anschluss gefunden. Nicht, dass sie nicht gewollt hätte. Doch ihre Mitschüler hielten sie wie die meisten, die Marie kannten, für sonderbar. Ihre äußerliche Veränderung verstärkte diese Meinung.
Marie fieberte darauf hin, bald wieder ihre Mutter besuchen zu dürfen. Auch wenn sie in den letzten Jahren nie wirklich auf sie reagiert hatte, konnte Marie sich in diesen wenigen Stunden wenigstens vorstellen, wie schön ihr Leben mit ihr verlaufen wäre.
Seit zwei Jahren durfte Marie alleine in die Anstalt gehen. Tante Irin war es verhasst, ihre Schwester so zu sehen. In einem Zustand, in dem sie nichts wahrnahm, auch nicht die Maßregelungen ihrer Schwester.
Mit neun Jahren hatte Onkel Menos Marie einmal begleitet. Damals hatte er seine Schutzbefohlene auf halber Strecke vergessen und ließ sie mutterseelenalleine in der U-Bahn sitzen.
An jenem Tag hatte Marie das letzte Mal geweint. Mit dem Gefühl, keine Tränen mehr zur Verfügung zu haben, beschloss sie damals, sich auf niemanden mehr zu verlassen und so gut wie möglich alleine durchs Leben zu gehen.
In Gedanken versunken wartete Marie auf die Straßenbahn. Die Hektik der letzten Stunde und die Angst vor ihrem Traum waren verflogen. Sie schwelgte in ihren Tagträumen und genoss die wenigen Augenblicke, in denen sie alleine war.
Als sie sich das nächste Mal auf ihre Umgebung konzentrierte, saß sie in der U-Bahn. Ihr gegenüber saß ein sympathischer, älterer Mann mit Trenchcoat und abgetragenem Hut. Marie schmunzelte, als sie auf seinen Schuhen Blumen und Schmetterlinge erblickte, die mit Buntstift aufgemalt waren.

Sie stellte sich vor, was er in seinem Leben getan hatte und was ihn geprägt haben könnte. Das war eine Beschäftigung, der Marie mit Begeisterung nachging. Sie sah Menschen an, versuchte sich vorzustellen, wie ihr Leben bis dato verlaufen war und was sie sich denken könnten. Meistens sah sie es regelrecht vor sich.
Obwohl sie dabei immer nur vorsichtig hinter ihrer Kapuze hervorlugte, war es vorgekommen, dass sich ihre Mitmenschen gestört fühlten, da Marie sie anstarrte, ohne es zu bemerken.
Marie war davon überzeugt, dass ihr ein Großvater von vier Enkelkindern gegenübersaß, der in seiner Rolle vollends aufging. Sie bemerkte aber erst jetzt, wie er ihr ein strahlendes Lächeln schenkte. Marie fühlte sich gestört und durch die Blicke ihres Gegenübers irritiert. Nervös zupfte sie an ihrer Kapuze und starrte demonstrativ aus dem Fenster. Sie mochte nicht, wenn man sie ansah. Unruhig rutschte Marie auf ihrem Sitz herum, da sie in der Spiegelung des Fensters sah, wie sie der Mann weiterhin anlächelte.
Ein undefinierbarer Druck in ihren Ohren ließ sie wieder aufblicken. Alles um Marie herum schien mit einem Mal still und regungslos, als ob sie in einem Vakuum wäre. Solche bizarren Zustände waren keine Seltenheit für Marie. Sie war üblicherweise die Einzige, die diese Veränderungen wahrnahm. Momentan verhielt sich das jedoch anders. Dieser Mann schien wie sie zu empfinden und nickte ihr aufmunternd zu.
Nicht nur durch ihn fühlte sich Marie jetzt beobachtet. Ihr starkes Herzklopfen durchbrach die Stille in ihrem Kopf und sie sprang abrupt auf. Sie wankte vorwärts und trat einer Frau auf die Füße. Eine kurze Entschuldigung murmelnd stolperte sie in den Gang, während der Mann im Trenchcoat die Hand hob, als wollte er nach Marie greifen. Obwohl sie noch nicht an ihrem Bestimmungsort angekommen war, trat sie vorzeitig an die Türe des Wagons heran und versuchte die vermeintlichen Blicke des Mannes in ihrem Rücken zu ignorieren. Unwillkürlich griff Marie nach ihrer Halskette, ihr einziges Andenken an ihre Mutter. Diese unbewusste Handbewegung beruhigte sie. Ohne es zu bemerken griff sie immer nach den Perlen an ihrer Kette, wenn sie nervös und unruhig war.
Ihr lief ein Schauer über den Rücken und sie dachte: was für ein seltsamer Tag!
Um sich zu beruhigen, schloss Marie kurz die Augen und atmete tief ein und wieder aus. Als sie in die Station einfuhren, in der sie aussteigen wollte, sah sie mit Beunruhigung im Spiegelbild des Flachglases eines der Fenster wie der Mann aufstand, um ebenfalls in dieser Station die U-Bahn zu verlassen.
Als die Türen aufschwangen, huschte Marie sofort hinaus. Sie drängte sich durch die Menge und hoffte, ihren vermeintlichen Verfolger abzuhängen.
Nervös trat sie auf die erste Stufe der Rolltreppe und drehte sich um. Da war er, fünf Meter hinter ihr und blickte sie unablässig an. Ein starkes, unsichtbares Band, das zwischen ihnen existierte, griff nach ihrem Bewusstsein und verankerte sie in einem absonderlichen Zustand der Trägheit. Alles bewegte sich wie in Zeitlupe. Selbst die Zeit schien still zu stehen.
Oben am Ende der Rolltreppe angelangt stolperte Marie. Sie fiel wie im Schnellvorlauf zurück ins Hier und Jetzt. Unsanft wurde sie von Passanten vorwärtsgedrängt. Schnell hatte sie sich wieder gefangen und nahm sich vor, ihrem geplanten Weg zu folgen.
Die Verbindung, die sie zu ihrem unbekannten Verfolger nach wie vor verspürte, sollte sie jetzt nicht mehr von ihrem ursprünglichen Ziel abhalten. Sie musste zur Schule.
Mittlerweile ging sie einen langen und breiten Gang entlang, der sie direkt in Richtung Oberfläche leitete. Ihr Weg war links und rechts mit grünlichen Neonlichtern gesäumt. Gebannt auf das grüne Licht starrend, riss sie ihren Blick gewaltsam davon los, nachdem sie ein Vibrieren in den Augen wahrnahm. Waren diese Leuchten immer schon hier gewesen?
Konzentriert auf ihren Weg widerstand Marie dem Drang, sich umzusehen. Sie konnte sich nicht erlauben, zu spät zur Schule zu kommen. Marie versuchte ihre Gedanken auf ihre erste Unterrichtsstunde zu richten, als sie den Mann neben sich gehen sah. Zuerst ging sie etwas langsamer und dann wieder schneller, um zu beobachten, ob er ihr folgte. Nervös musste sie feststellen, dass er seine Schritte ihrem Tempo anglich.
Marie zögerte. Inmitten der vielen Leute konnte ihr nichts passieren, daher blieb sie abrupt stehen und sprach den Mann direkt an: »Was wollen sie von mir? Wenn sie mich nicht in Ruhe lassen, rufe ich um Hilfe.«
»Ich will dir nichts tun, Idjana«, sagte er freundlich lächelnd.
»Sie müssen mich verwechseln. Ich heiße nicht Idjana«, wehrte Marie ab und ging zielstrebig weiter.
»Ich muss dir etwas Wichtiges mitteilen«, zischte der Mann hinter ihr.
Marie wendete ihren Kopf zur Seite, doch der Mann ließ sich nicht abwimmeln. Er trippelte rechts neben Marie her und redete unermüdlich auf sie ein.
»Mein Name ist Lenu. Es steht ein schlimmes Unglück bevor. Wir brauchen deine Hilfe. Hups!« Er stolperte über seine Füße. Unbeirrt hastete er auf Maries linke Seite und plapperte weiter: »Es existieren andere Welten, die sich auf eure Welt zubewegen. Man hat mich geschickt, um dir von deiner Aufgabe zu berichten.«
Unermüdlich hastete Marie voran, bis er endlich seine Schritte verlangsamte und aufgab.
»Hör mir doch bitte zu. Es ist wirklich wichtig«, war das letzte, was sie von dem offensichtlich verwirrten Mann hörte.
In einem sicheren Abstand wendete sie sich noch einmal kurz um und schüttelte genervt den Kopf. Warum musste das immer ihr passieren? Färbte ihre Mutter auf sie ab, oder wurde sie vielleicht selbst langsam verrückt?
Erschrocken hob sie den Arm und blickte auf ihre Armbanduhr.
»Verdammt, in zehn Minuten beginnt die Schule!«